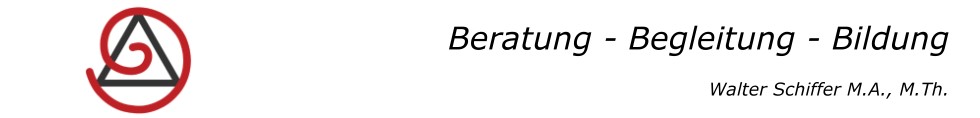Ruth C. Cohn - Nachruf
Helmut Reiser: Der Erfolg der dynamischen Balance. Zum Tod der Psychotherapeutin und Pädagogin Ruth C. Cohn. In: Pädagogik 7-8 (2010), S. 91
Am 30.1.2010 starb Ruth C. Cohn im Alter von 97 Jahren. Ruth Cohn war eine kreative Persönlichkeit, die einen visionären Humanismus mit einer nüchternen Einschätzung von Chancen und Störungen verband und unermüdlich für den Pragmatismus der kleinen Schritte in Richtung einer menschlicheren Gesellschaft eintrat.Ruth Cohn emigrierte bereits mit 21 Jahren wegen der Nationalsozialisten nach Zürich, wo sie Psychologie, Pädagogik, Philosophie und Literaturwissenschaft studierte und sich zur Psychoanalytikerin ausbildete. 1941 übersiedelte sie mit ihrer Familie in die USA und baute sich unter schwierigen Bedingungen eine Existenz als Psychotherapeutin auf. Als Dozentin in der psychoanalytischen Ausbildung fand sie neue Wege der Einzel- und Gruppentherapie und der Schulung von Psychoanalytikern.
Themenzentrierte Interaktion
In den siebziger Jahren kehrte die in den USA gefeierte Psychoanalytikerin und Gruppentherapeutin nach Europa zurück und brachte ein neues Konzept der Arbeit mit Gruppen mit, das sie zusammen mit einem Kreis von Psychotherapeutinnen und -therapeuten in New York erarbeitet hatte. In den stürmischen Jahren des Aufbruchs der Humanistischen Psychologie, der Gruppentherapie und der Erlebnistherapie in den USA entwickelte sie ihr Konzept der Gruppenarbeit aus dem Wunsch heraus, die Erkenntnisse und befreienden Möglichkeiten der Psychoanalyse und Sozialpsychologie möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen: Die Themenzentrierte Interaktion (TZI).
In den deutschsprachigen Ländern, in den Niederlanden und Belgien breitete sich die TZI rasch aus und begeisterte Psychotherapeuten, Lehrerinnen, Theologen, Erwachsenenbildnerinnen und Hochschullehrer. Die Universitäten Hamburg und Bern verliehen Ruth Cohn die Ehrendoktorwürde. Ruth Cohn nahm 1974 ihren Wohnsitz in der Schweiz.
Der Erfolg der Themenzentrierten Interaktion ist auch auf die außergewöhnliche Persönlichkeit Ruth Cohns zurückzuführen. Sie vereinte in ihrer Person Charisma und Nüchternheit, Visionäres und Bescheidenheit. Ihre Leitmotive, dass jeder Mensch zu innerer Klarheit und Entscheidungsfähigkeit gelangen kann und dass Autonomie und Verbundenheit sich gegenseitig durchdringen und stärken können, wurden für jede Person spürbar, die mit ihr in Kontakt kam. Die realistische Sicht der Beschränktheit des Machbaren und der Unausweichlichkeit von Störungen verband sie mit dem unerschütterlichen Vertrauen, dass Erweiterung der Grenzen möglich ist. Dies bedingt persönliche und gemeinsame Auseinandersetzung, ermöglicht Wachstum, benötigt aber auch eine gewisse Beharrlichkeit und Geduld.
Wieder in die Balance kommen
Das Konzept der TZI achtet darauf, dass die emotionalen und expressiven Bedürfnisse aller Teilnehmenden ebenso angesprochen werden wie die psychodynamischen Prozesse in der Kooperation und die sozialpsychologischen Gegebenheiten. Die sachliche Aufgabe der Gruppe wird auf diese drei Faktoren bezogen und mit ihnen im Thema verbunden. Die Einführung und Benennung eines Themas nach TZI ist deshalb mehr als eine schlichte Überschrift. Das Thema enthält vielmehr in seiner Formulierung das Potential, die Dynamiken der in unterschiedlichen Richtungen laufenden Faktoren zu entfalten und sie immer wieder in der Bearbeitung der Sachaufgabe zu bündeln. Dieser Prozess der Dynamisierung und des Wieder-in-die-Balance-Kommens wird durch jeweils passende Strukturangebote des Arbeitsprozesses unterstützt und vorangetrieben.
Die Leitungspersonen beteiligen sich an der gemeinsamen Arbeit auch durch persönliche Beiträge, aber nur soweit, als die Arbeitsfähigkeit und die Selbstregulation der Teilnehmenden dadurch unterstützt werden. Diese reflexive und zugleich emotionale Beteiligung ist ein weiteres Erfordernis des dynamischen Balancierens. Nähe und Distanz werden so nicht als ein Entweder-Oder begriffen, sondern als eine dynamische Gegensatzeinheit.
Dahinter steht ein Konzept von individueller Entwicklung, das auf der Annahme basiert, Autonomie wachse mit einer größeren Bewusstheit von Verbundenheit und die Fähigkeit zum »Leben in Verbundenheit« steige mit einem höheren Grad von Autonomie.
Dynamisches Balancieren im Sinne der TZI stellt hohe Anforderungen an die Leitung, nicht nur an Geschicklichkeit und Kenntnisreichtum von Handlungsformen, sondern vor allem auch an Persönlichkeitsfaktoren wie Intuition, Aufrichtigkeit, Empathie. Aber auch dieses - so die Überzeugung von Ruth Cohn - ist erlernbar, wenn man sich gestatten kann, seine Bedürfnisse wichtig zu nehmen.
Obwohl die aus der Psychoanalyse und der Humanistischen Psychologie hervorgegangene TZI viele »moderne« Züge des Konstruktivismus, der Systemtheorie und der Theorien zur Selbstregulation vorwegnahm, stellt sie sich doch radikal gegen den Zeitgeist der Beschleunigung, des Effektivitätswahns und des Eliteglaubens, und ihre Vertreterinnen und Vertreter tun dies bewusst. Das Vertreten einer Werte-Orientierung im pädagogischen Handeln scheint jedoch wieder gefragt zu sein. Die dynamische Balance hat alle Chancen, ein Erfolgskonzept zu bleiben.